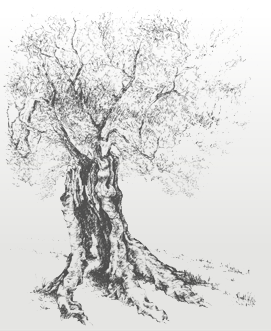Schon bei dem Weiterbildungstreffen zeichnete sich ab, dass die größte Herausforderung für die Oliviers erneut die Klimasituation werden wird. So erhielt Dimitrios Sinanos bereits während des Treffens die Nachricht von nahezu 40°C bei sich zu Hause in Klenia auf dem nördlichen Peloponnes.
In den Tagen und Wochen danach erhielten wir weitere Berichte der Oliviers über die Situation zur Olivenblüte und den ersten Fruchtansätzen. Es ergibt sich daraus ein gemischtes Bild, viele klagten über Wassermangel und zu früh einsetzende hohe Temperaturen, die Blüten und Fruchtansätze geschädigt haben. So entschieden wir uns schon jetzt für Besuche, um uns selbst ein Bild davon zu machen und uns gegebenenfalls frühzeitig über notwendige Hilfsmaßnahmen auszutauschen.
Katalonien – Spanien
 Josep Maria und Flavia trafen wir in ihrer neuen Mühle an, wo Josep die Sommerpause zu ihrer weiteren Fertigstellung nutzte. Nicht unüblich ergaben sich nach ihrer erstmaligen Nutzung bei der letzten Ernte noch Notwendigkeiten für kleinere Verbesserungen an der Technik und den Räumlichkeiten für die Abläufe des gesamten Arbeitsprozesses. Als größeres Projekt zur Entwicklung einer abfallfreien Olivenmühle wird es in den nächsten Jahren weiterhin zu Veränderungen kommen, für die dann wieder die Sommerpause genutzt werden wird. So besprachen wir auch die Fortsetzung der ersten Forschungsaktivitäten bei der kommenden Ernte, die wir in Kooperation mit dem Olivenmühlenhersteller GEA Westfalia in Oelde hier durchführen. Es geht dabei um die Erfassung und stoffliche Zusammensetzung aller Bestandteile der Olive und ihrer Veränderungen in den einzelnen Abschnitten des Mühlenprozesses.
Josep Maria und Flavia trafen wir in ihrer neuen Mühle an, wo Josep die Sommerpause zu ihrer weiteren Fertigstellung nutzte. Nicht unüblich ergaben sich nach ihrer erstmaligen Nutzung bei der letzten Ernte noch Notwendigkeiten für kleinere Verbesserungen an der Technik und den Räumlichkeiten für die Abläufe des gesamten Arbeitsprozesses. Als größeres Projekt zur Entwicklung einer abfallfreien Olivenmühle wird es in den nächsten Jahren weiterhin zu Veränderungen kommen, für die dann wieder die Sommerpause genutzt werden wird. So besprachen wir auch die Fortsetzung der ersten Forschungsaktivitäten bei der kommenden Ernte, die wir in Kooperation mit dem Olivenmühlenhersteller GEA Westfalia in Oelde hier durchführen. Es geht dabei um die Erfassung und stoffliche Zusammensetzung aller Bestandteile der Olive und ihrer Veränderungen in den einzelnen Abschnitten des Mühlenprozesses.
Ein Winter ohne Regen
Ein anschließender Besuch in den Olivenhainen der Umgebung zeigte uns die Wirkung des ausgebliebenen Regens im Winter und der anhaltenden Trockenheit, sowie die Schutzlosigkeit des Bodens in der bisher üblichen Anbauweise der Olivenlandwirtschaft.

Bilder, die sich uns beim Durchstreifen der Olivenhaine immer wieder boten, vertrocknete Blüten, kümmerliche Fruchtansätze und manche Bäume trugen auch etwas mehr.

Von allen Pflanzen bereinigte Böden können der Trockenheit nichts entgegen setzten. Auch die ausgelegten Wasserschläuche sind dann nutzlos und bleiben leer, weil hier alles verfügbare Wasser zunächst dem Tourismus vorbehalten ist. Bei großer Trockenheit bleibt dann nur wenig oder gar nichts für die Landwirtschaft übrig.
Josep berichtet, dass die Situation nicht einheitlich sei, während in manchen Regionen die Bäume aussehen wie hier auf den Bildern, gibt es in anderen einen durchschnittlich normalen Olivenbehang. Erst im September wird man sehen, welchen Ertrag es geben wird, dass er gut wird glaubt Josep aber eher nicht.
Bessere Nachrichten kommen aus Andalusien. Nach der Trockenheit im letzten Jahr mit großen Ernteausfällen hat es dort jetzt viel geregnet und die Stauseen sind wieder mit 70% Wasser gut gefüllt, was eine gute Ernte erwarten lässt.
 Winzer und Oliviers leiden gemeinsam
Winzer und Oliviers leiden gemeinsam
Unsere Zeit reichte noch zu einem Ausflug in die Hochebenen des Priorats und des Montsants zur Wein-Cooperative Capçanes und Jürgen Wagner. Auf dem Weg dorthin wurde das ganze Ausmaß der Trockenheit in den leeren Stauseen sichtbar, die nur noch mit 5% Wasser gefüllt waren. Den Winzern geht es damit ebenso wie den Olivenlandwirten. Die Trockenheit hat die Reben nicht richtig wachsen lassen und Jürgen zeigte uns die nur klein ausgebildeten Trauben, die an ihnen hingen. Jürgen blickt aber nicht nur pessimistisch auf die Trauben, er sprach von Glück, dass die zu dieser Jahreszeit unüblich geringen Temperaturen von nur knapp über 20° Celsius den Pflanzen gerade gegen die Trockenheit helfen.
Peloponnes – Griechenland
Mit dem Credo des Weiterbildungstreffens „ohne Boden ist alles nichts“ wollten wir uns nicht nur ein eigenes Bild von den Olivenhainen im Norden des Peloponnes bei Dimitrios und im Süden bei der Kooperative Eleonas machen, sondern auch das Humuserde-Projekt von Dr. Eisenbach besuchen.
Auch Dimitrios trafen wir bei der Arbeit, neben seiner Mühle brachte er gerade zwischen den Olivenbaumreihen Zucchinisamen in die Erde. Gewissermaßen eine Notmaßnahme, die Trockenheit hatte zusammen mit den hohen Temperaturen erneut einen großen Teil der Olivenblüten vertrocknen und verbrennen lassen. Lediglich auf den wenigen Hainen, die er bewässern kann, konnten sich Oliven bilden. Dimitrios erwartet damit erneut nur einen Ertrag von 15 bis 20% Oliven. So wie ihm geht es allen in der Region.

Auf den bewässerten Hainen zeichnet sich eine mittelmäßig gute Ernte ab.

Auf einem nicht bewässerten Olivenhain zeigt uns Dimitrios die Trockenschäden. Die Blüten sind hier nicht nur vertrocknet, sondern z.T. durch die Hitze auch verbrannt. Das hat auch manche Triebspitzen der Zweige erfasst, die dadurch in diesem Jahr nicht mehr wachsen werden. Das hat bereits Folgen für das nächste Jahr, weil sich Blüten immer nur an den einjährigen Trieben bilden.

Ein kleiner Lichtblick – die Aprikosen-Konfitüre
Bei unserem Eintreffen war es gerade der letzte Tag, an dem die ganze Familie die letzte Partie ihrer beliebten Aprikosen-Konfitüre herstellte. Durch die früher als sonst einsetzende Blütezeit der Aprikosen waren die Früchte bereits vor dem Einsetzen der Hitzewelle gut entwickelt, so dass sie diese unbeschadet überstanden. Dimitrios konnte damit eine quantitativ und qualitativ besonders gute Ernte der Aprikosen einbringen. Frühzeitig hatten wir ihn gebeten die doppelte Menge an Konfitüre herzustellen, um ihm unter dem Motto „Aprikosen statt Oliven“ zur Herbst-Kampagne solidarisch zu helfen seine absehbaren Verluste der Oliven etwas abzumildern.
Zwei Seminartage im Biocycling Park in Kalamata
Bereits beim Weiterbildungstreffen war Dimitrios von den Vorträgen zur Herstellung von Humuserde und dem biozyklisch-veganen-Anbau auf ihr, nach der Methode des Agrarwissenschaftlers Dr. Eisenbach, angetan und war nun darauf gespannt, ihn in Kalamata zu treffen und sein Projekt nicht nur in Bildern zu sehen. Die Verwendung von 35% Oliventrester und 20% Olivenblättern zur Herstellung der Humuserde ist für Olivenmüller wie Dimitrios besonders interessant. Der Verzicht auf tierische Exkremente bei der Kompostierung erfordert weitere Zusätze aus Gemüse- und Gemüsepflanzenresten zu denen Dimitrios in seinem Dorf einen Zugang hätte. Auf der Fahrt nach Kalamata holten wir noch Nikos ab, den Vorsitzenden der Kooperative Eleonas und er hatte bessere Nachrichten zu den Oliven dabei. In ihrer Region um Pylos und auf der Hochebene von Gargaliani hatte es im Winter geregnet, sie haben keine ausgeprägte Trockenheit und die Blüten haben Früchte angesetzt, so dass eine normal gute Ernte zu erwarten ist.
Zusammen verbrachten wir mit Johannes Eisenbach zwei spannende Tage in seinem Biocycling Park. Das Thema wird uns noch länger beschäftigen und wir stellen das geplante Klima-Versuchsprojekt bald ausführlicher vor, wenn Dimitrios es zur nächsten Vegetationsperiode beginnt und arteFakt ihn dabei unterstützen wird. Mit den folgenden Bildern vermitteln wir einen ersten Eindruck.

Apulien, Abruzzen & Umbrien – Italien
Kurz vor der Abreise nach Apulien erreichte uns noch eine Nachricht von Gunther und Klaus Di Giovanna von Sizilien zu ihrer Situation: „Das Jahr ist nicht sehr produktiv, weil wir dieses Jahr 60% der Olivenbäume beschnitten haben und die Dürre im Winter und Frühling uns nicht hilft. Wir hoffen sehr auf Regen Ende August und Anfang September, der die Situation verbessern könnte, aber das ist natürlich nur eine Hoffnung. Regelmäßig wässern wir die Bäume und das hilft das Problem zu reduzieren. Eine bessere Prognose wird es erst im September geben können.“
In Bitonto wartete schon Michele Librandi auf uns, er war aus Kalabrien angereist, weil wir mit ihm die Aufnahme der Arbeit unserer kürzlich gegründeten Agroforst-Fachgruppe besprechen wollten, für deren Leitung wir Michele gewinnen konnten.
Ernteschwaches Jahr und Trockenheit im Süden
Im letzten Jahr hatten Kalabrien und Apulien eine außerordentlich gute Olivenernte. Einer guten Ernte folgt im Jahr darauf die Erholung der Bäume mit einem schwächeren Ertrag, was ein natürlicher Biorhythmus ist. Michele Librandi aus Kalabrien, Giuseppe Lombardi aus Andria und Giulio Sciascia aus Minervino berichten alle, dass die Trockenheit weniger die Blüten betroffen hat, als dadurch jetzt das Wachstum der Fruchtansätze gefährdet ist.
Palombaio
Bei einem Besuch unseres Patenschafts-Olivenhains und Landschaftsmuseums in Palombaio konnten wir im Landschaftsbild die Auswirkungen der Trockenheit sehen, vieles an Pflanzen war vertrocknet, dann wurden wir jedoch von unseren Olivenbäumen mit vielen und gut gewachsenen Oliven überrascht. Es überraschte auch Michele, da wir den Hain ja nicht bewässern können.

Bild 1: Bei Regen wird manches wieder grün, etliche Pflanzen werden aber neu gesetzt werden müssen.
Bild 2: Bereits gut gewachsene Ogliarola-Oliven, die eine gute Ernte andeuten.
Andria
Wie Dimitrios auf dem Peloponnes hatte auch Giuseppe Glück mit einer guten Ernte seiner Pfirsiche und Nektarinen, sie reifen bei der Hitze aber schneller und die Ernte beginnt daher bereits morgens um 4.00 Uhr und wird vor der einsetzenden Mittagshitze beendet.

Hier trafen wir auch unser Genossenschaftsmitglied, Marco aus Bayern, der zur Obsternte angereist war, um beim Ernten mit Giuseppe italienisch zu lernen.
Minervino Murge
Weiter ging es nach Minervino Murge um Mauro zu beglückwünschen, er war erneut zum Vorsitzenden der Cooperative Emanuel De Deo gewählt worden. In der Cooperative hatten sie gerade den Hartweizen eingebracht und Giulio berichtete enttäuscht, dass die Trockenheit nur einen mäßigen Ertrag erbracht hatte. Wir waren hier nicht nur wegen der Oliven, die Cooperative könnte ein Partner für erste größere Pilotprojekte zur Humuserde und zur Gewinnung von Pflanzenkohle im Rahmen unserer Projekte der Kreislaufwirtschaft sein und an beidem haben sie Interesse.
Zum Abschluss trafen wir noch unseren langjährigen Freund Antonio Ippolito, den Vorsitzenden des Heimatvereins von Minervino, der nach langer und schwerer Krankheit wieder gut dabei und fast der Alte ist und wieder die Kraft hat, den Jugend-Fussballaustausch von Minervino mit unserer Samtgemeinde in Gang zu bringen. Wir freuen uns darauf.

Bild 1: Mauro und Giulio von der Cooperative DeDeo.
Bild 2: Antonio Ippolito
Castilenti in Umbrien

Weiter ging es nach Castilenti in die Abruzzen zu den Tini`s, wo sich die ganze Familie für uns eingefunden hatte. Daria und Dora, die Mütter von Vincenzo und Roberta hatten sich wieder ins Zeug gelegt und ein üppiges Fisch- und Meeresfrüchteessen vorbereitet. Vincenzo wies noch darauf hin, dass die Sauce aber von seinem Vater Bruno gemacht wurde, das könne keiner so gut wie er.
Roberta tischt auf – mehr Italien geht nicht.
So liebevoll und genussvoll die Speisen für uns immer zubereitet werden, sind sie doch eine der Anstrengungen der Besuche, weil es immer zu viel ist und es schwer fällt das gastfreundliche Nachfüllen der Teller abzuwehren.
Auch hier in den Abruzzen erwarten Vincenzo und Roberta keine üppige Ernte, aber wenn das Wetter keine Kapriolen schlägt, wird es für sie und uns reichen. Mit ihrer kleinen Olivenmühle interessieren sich beide auch für das Projekt der Humuserde, weil sie mittlerweile an die Abnehmer des Oliventresters Geld bezahlen müssen und eine Selbstverwertung Vorteile bringen könnte. Wir informierten sie über unseren Besuch in Kalamata und erörterten die Möglichkeiten für eine Umsetzung hier in Castilenti, dann ging es schon wieder weiter nach Umbrien.
Trivio in Umbrien

Hier in dem kleinen Ort in 900 Meter Höhe, wo die Straße in den Sibillinischen Bergen endet, empfingen uns nicht nur Gloria und ihre kleine Tochter Lucrezia mit großer Freude, sondern endlich auch angenehme Temperaturen. Statt 37 bis 38°C, die uns bisher begleitet hatten, waren es hier für uns gewohnte sommerliche 28°C und am Abend mussten wir bei 21°C Kühle sogar einen Pullover überziehen.
Gloria Angelini mit Tochter Lucrezia (9 Monate alt) und Klaus Haase, unser langjähriger Dolmetscher und ehemaliger Leiter der Reisen nach Italien.
Domenico und Antonio kamen erst spät von der Baustelle, sie errichten gerade eine größere Lagerhalle und die Ernte der Lenticchie war bereits im Gange, zu der uns Domenico am nächsten Morgen mitnahm.

In über 1.000 Meter Höhe wachsen hier die Berglinse Lenticchie und die Urerbse Roveja. Die Lenticchie ist bereits gemäht, die Roveja braucht aber noch Zeit und Domenico lässt uns von ihnen kosten, die noch grün bereits schon sehr gut schmecken.
Bettona in Umbrien
 Die letzte Station und leider nur mit Zeit für einen kurzen Besuch waren Graziano und Romina Decimi.
Die letzte Station und leider nur mit Zeit für einen kurzen Besuch waren Graziano und Romina Decimi.
Sie und auch ihre Tochter Margherita konnten in diesem Jahr nicht zu dem Weiterbildungstreffen kommen und so waren die wenigen Stunden vollgepackt mit Informationen zu den dort behandelten Themen und Ergebnissen. Wie in den Abruzzen erwarten Graziano und Romina keine so drastischen Ernteeinbußen wie in anderen Regionen. Die Trockenheit macht sich auch hier bemerkbar, die Blüte war aber gut und es haben sich die ersten Fruchtansätze schon gut zu Oliven entwickelt.
Die Reise ist zu Ende und von Bologna aus geht es zurück nach Bremen. Zur Olivenernte kommen wir dann wieder zu unseren Freunden und Oliviers zurück, dann um die Oliven zu ernten.
Kommentare lesen und schreiben ...