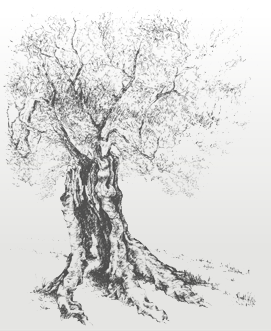Wilstedt, 30. Oktober 2024
Guten Tag liebe Olivenbaum-Patinnen und -Paten und Mitglieder,
gerade sind wir aus Apulien von unserem Patenschafts-Olivenhain und Landschaftsmuseum in Palombaio zurückgekommen, und es gibt Interessantes zu berichten.
In den letzten „Auskünften“ hatten wir mehrfach über die Auswirkungen des Klimawandels auf die Olivenlandwirtschaft berichtet und darüber, wie wir gemeinsam mit den Oliviers in der Agroforstwirtschaft nach Lösungen suchen, um den Folgen des Klimawandels entgegenzuwirken. Auch wenn es bereits etliche Projekte gibt, die Agroforstwirtschaft in der Praxis erproben, sind die Herausforderungen in ihrer Komplexität so vielfältig, dass es für die Olivenlandwirtschaft noch keine Vorlagen gibt, die wir einfach übernehmen könnten. Für alle Ideen müssen wir zunächst mit kleineren Pilotprojekten eigene Erfahrungen sammeln und ihre Umsetzbarkeit erkunden.
Bei unserem letzten Weiterbildungstreffen mit den Oliviers sowie den uns beratenden Fachexperten und -expertinnen verabredeten wir, dass alle Oliviers auf ihren Olivenhainen eine begrenzte Fläche von 3 x 4 Olivenbäumen markieren und auf dieser Fläche, im Umfang eines kleinen Gartens, verschiedene Versuche durchführen werden. In diesem Zuge haben wir uns entschieden, auch den Patenschafts-Olivenhain als „Versuchslabor“ mit einzubeziehen.
Für die Konzeption der Versuche, deren Begleitung und Auswertung haben wir eine Agroforst-Fachgruppe gebildet, deren Leitung Michele Librandi (Olivenöl No.3) als diplomierter Agronom übernommen hat.
Unsere jüngste Reise nach Apulien diente der Umsetzung eines ersten Pilotprojekts auf einem kleinen Teil der zwei Hektar großen Fläche des Patenschafts-Olivenhains. Mit dabei waren Giuseppe Lombardi aus Andria (Olivenöl No. 7 grün), Davide Colasanto aus Ruvo (Humusproduzent und Regenwurmzüchter), Domenico Angelini aus Trivio (Erhaltungszüchter alter Sorten von Hülsenfrüchten) und fleißige Helfer, darunter Olivenbaumpatin Ute aus Bremen, die sich so in den Olivenhain verliebt hat, dass sie dort ihren siebzigsten Geburtstag feiern wird.
Humusaufbau, Wasserspeicherfähigkeit, Biodiversität – das sind die Schwerpunkte der ersten Versuchsreihe. Auch wenn der Patenschafts-Olivenhain in seiner Gesamtanlage noch immer einer Gartenanlage mit verschiedensten Nutzpflanzen gleicht und nicht zu einem monokulturellen Hain ausschließlich mit Olivenbäumen entwickelt wurde, gibt es auch hier große Flächenanteile, die nicht genutzt werden. Früher weideten dort Schafe. Anders als in den meisten monokulturellen Hainen lassen wir hier Wildgräser und -kräuter wachsen und halten den Boden nicht „nackt“. Doch das allein reicht nicht mehr aus, um den immer längeren Trockenperioden mit hohen Temperaturen zu trotzen. Wiesen sind starke Wasserverbraucher, und vertrocknete Gräser schützen den Boden nur wenig.
Um die Böden resistenter gegen Trockenheit und Hitze zu machen, was letztlich auch den Olivenbäumen hilft, wird eine durchdachte Bewirtschaftung erforderlich sein. Dabei setzen wir auf Pflanzensynergiegemeinschaften, die sich weitgehend selbst und gegenseitig dabei unterstützen, mit den veränderten Klimabedingungen zurechtzukommen. Im besten Fall können einige dieser Pflanzen sogar zusätzlichen Ertrag bringen, während andere ausschließlich dem Ziel der Widerstandsfähigkeit dienen. Künftige Oliviers werden sich damit zu Mischlandwirten entwickeln müssen, was erhebliche Veränderungen in ihrem Lebensrhythmus mit sich bringen wird. Neben der materiellen Herausforderung des landwirtschaftlichen Transformationsprozesses wird auch die mentale Transformation nicht weniger anspruchsvoll sein und vermutlich ähnlich lange dauern wie das Wachsen eines Baumes, bis er Schatten spendet.
Dem Patenschafts-Olivenhain kommt mit seiner Laborfunktion eine größere Rolle zu, als wir bisher angenommen haben. Hier sind wir frei von den wirtschaftlichen Zwängen, die unseren Alltag bestimmen, und können mutig experimentieren.
Ein Olivenbaum kann sehr tief reichende Wurzeln bilden. Steht er jedoch allein ohne pflanzliche Nachbarn, tut er das nicht und bildet eher flachere Wurzeln. Daher setzen wir auf den ersten Versuchsflächen Büsche, die nicht tief wurzeln können, neben die Olivenbäume. Diese zwingen den Olivenbaum, tiefer zu wurzeln, wo er weniger Konkurrenz hat und die feuchteren Bodenschichten erreicht. Zwischen den Büschen verändert sich der Boden; bei Wind sammeln sich dort Blätter und kleine Zweige, die den Boden bedecken, ihn feuchter halten und eine Mikrowelt von Kleinstlebewesen schaffen. Diese finden hier Nahrung, lockern den Boden, lüften ihn, bilden Humus und versorgen ihn mit Nährstoffen. Wir haben mit Rosmarin, Salbei, Lavendel und Kräuterbüschen begonnen, die zum Teil auch ätherische Düfte verströmen. Diese Düfte locken Nützlinge an, halten Schadinsekten fern, schaffen neue Lebensräume und fördern so die Biodiversität. Trotz mehrfacher Bewässerung haben sich Lavendel und Salbei jedoch nicht bewährt, da sie den hohen Temperaturen nicht standhalten konnten. Eine intensivere Bewässerung würde unser Ziel, signifikant weniger Wasser zu verbrauchen, verfehlen. Deshalb haben wir sie teilweise durch andere, buschigere und höher wachsende Pflanzen ersetzt und hoffen nun auf bessere Ergebnisse.
Die bisherigen Brachflächen zwischen den Olivenbäumen sollen zukünftig zu Wirtschaftsflächen mit Nutz- und Ertragspflanzen werden. Auf Anraten von Domenico haben wir zunächst mit Leguminosen begonnen. Sie sind Stickstoffsammler und lockern verdichtete Böden auf. Zusätzlich haben wir ein kleines Gemüsebeet angelegt und experimentieren mit Permakulturmethoden zum Bodenschutz. Dabei werden als Unterlage für grob verrottete Olivenblätter Äste auf den Boden gelegt, die einer Verdichtung der Bodenoberfläche entgegenwirken. Unter diesem „Dach“ entsteht bald ein reges Bodenleben von Mikroorganismen und Kleinlebewesen, die den Boden auflockern, ihn fruchtbarer machen und feuchter halten.
Die erste, skeptische Reaktion der Oliviers auf dieses Konzept war: „Ja, und wie lege ich dann meine Netze bei der Ernte aus? Und wie kann ich mit dem Traktor überall durchfahren?“ Diese Reaktion zeigt deutlich die doppelte Herausforderung, der wir uns gegenübersehen: die landwirtschaftliche und die mentale Transformation. Der Patenschafts-Olivenhain als Experimentallabor wird hier von großer Bedeutung sein. Mit dem Heranwachsen der Pflanzen werden wir neue Wege und praktische Lösungen entwickeln müssen, wie diese Prozesse funktionieren können. Bei den ausgewählten Nutzpflanzen, die jährlich geerntet werden, wird es darauf ankommen, ihre Vegetationszeiten und -rhythmen so abzustimmen, dass sie sich in der Aussaat und der Ernte ablösen und nicht parallel zueinander entwickelt werden.
Der 1-Euro-Museumstaler, den wir wegen all dieser klimatischen Herausforderungen kürzlich in den 1-Euro-Klimataler umbenannt haben, bleibt dabei im Hintergrund erhalten. Unsere Laborversuche greifen in vielfacher Weise auf die Wiederentdeckung alter Pflanzensorten und landwirtschaftlicher Kulturen zurück. Damit rücken wir den Boden und das Bodenleben wieder in den Mittelpunkt der Landwirtschaft – ein Aspekt, der über Jahrzehnte vernachlässigt wurde. Realistisch betrachtet, können wir damit zunächst nur Einfluss auf das Mikroklima gewinnen (siehe unsere Klimaleiter), und es wird fünf bis fünfzehn Jahre dauern, bis sichtbare und nachhaltige Erfolge erzielt werden. Wie immer ist es viel leichter, etwas zu zerstören, als es wieder aufzubauen.
Wir freuen uns, dass wir auf dem Olivenhain dank Ihrer Namensschilder über 180 Paten für jeweils einen Olivenbaum haben. Alle Bäume sind bereits vergeben. Wenn Sie uns auf unserem Klimaweg unterstützen möchten, erzählen Sie davon und klicken bei Ihrer Bestellung ab und zu einen 1-Euro-Klimataler mit an. Die Summe vieler kleiner Beträge hilft uns sehr bei der Finanzierung all dessen, was Sie auf den Bildern sehen. Wer im engen oder weiteren Sinne über fachliche und wissenschaftliche Kenntnisse und Fähigkeiten zu dieser Thematik verfügt und uns gelegentlich beraten oder sich der Agroforst-Fachgruppe anschließen möchte, ist herzlich willkommen.
Das ZDF hat sich für seine Sendereihe „Plan B“ für unsere Aktivitäten interessiert und vier Drehtage in Wilstedt, bei den Geschwistern Librandi in Kalabrien und auf unserem Patenschafts-Olivenhain in Palombaio in Apulien verbracht. Wir informieren Sie rechtzeitig, wann der Film gezeigt wird.
Kommentare lesen und schreiben ...